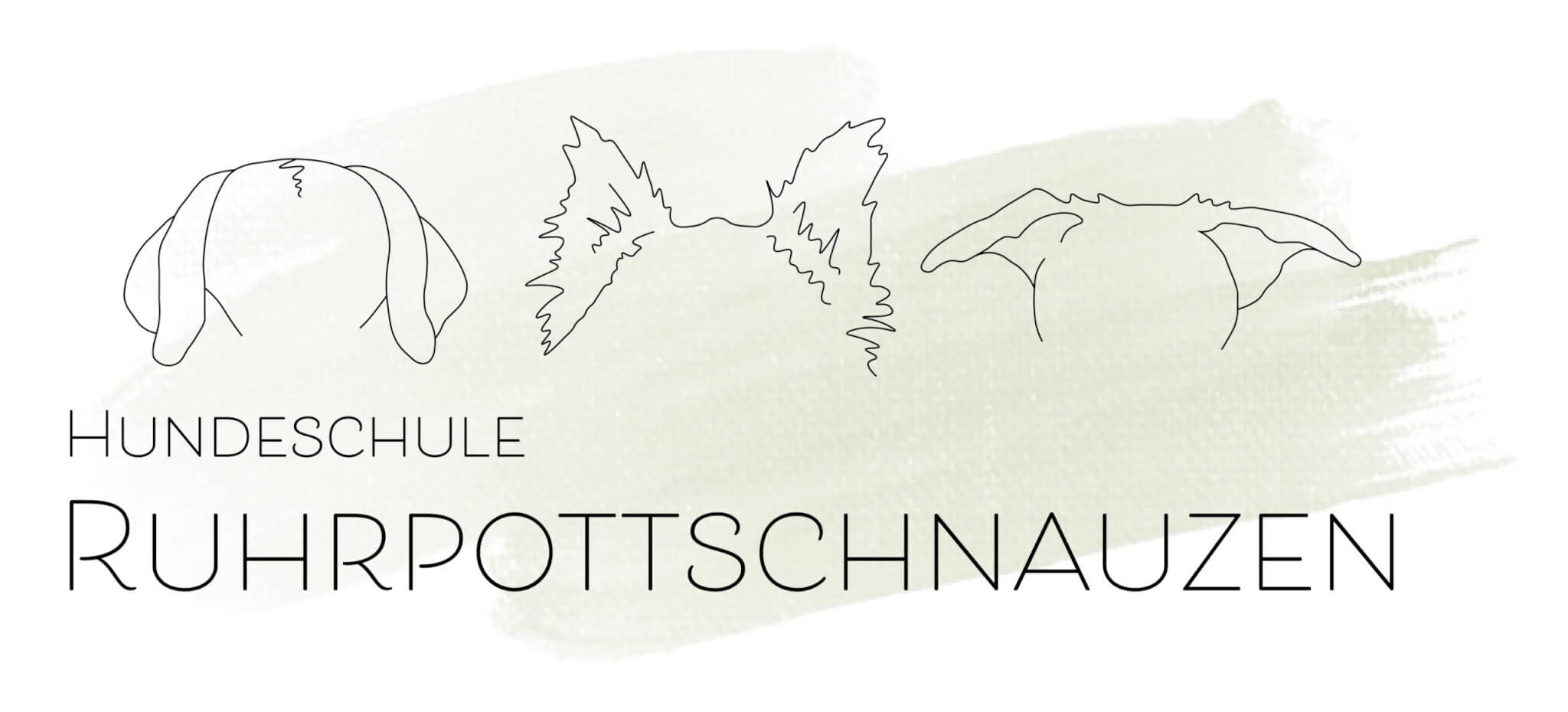“Der Kleine hat aber gar keinen Respekt vor Ihnen!”
“Der versucht Rudelführer zu werden!”
“Wie, Ihr kleiner Rüde hebt schon sein Bein beim Pinkeln?! Der ist aber ganz schön dominant für sein Alter!”
“Das Anspringen ist Dominanzverhalten! das müssen Sie sofort mit dem Alphawurf bestrafen!“
.. Ein kleiner Ausschnitt an Zitaten, die wohl alle frischgebackenen Hundeeltern im Laufe der Welpen- und Junghundezeit von anderen Hundehaltern hören.
Aber was ist dran an solchen Hundewiesenweisheiten? Was steckt hinter sogenanntem Dominanzverhalten bei Hunden?
Meist liegt der Fehler schon darin, welches Verhalten des Hundes überhaupt als dominant bezeichnet wird. Junghunde werden oft als stur, aggressiv und aufmüpfig abgestempelt und das wird dann auch noch gleich mit dem Oberbegriff dominant betitelt, was schlicht und einfach falsch ist!
Dominanz
Viele Hundehalter nutzen den Begriff Dominanz dazu, um das Verhalten des eigenen Hundes zu entschuldigen. Denn so wird nicht die eigene Erziehungsfähigkeit in Frage gestellt, sondern das Wesen des Hundes als Ausrede für sein Verhalten genutzt. Gleich nach dem Motto: „An dem Verhalten kann ich nichts ändern, er ist halt einfach ein sehr dominanter Hund!“. Dominanz ist aber keine Eigenschaft eines Hundes, sondern beschreibt immer eine Beziehung zwischen mindestens zwei Individuen. Und so eine Dominanzbeziehung muss sich durch gemeinsame Erfahrungen und Interaktionen entwickeln. Sie entwickelt sich im Einvernehmen beider Beteiligten und hat nicht viel mit dem zu tun, was im allgemeinen Sprachgebrauch unter Hundehaltern als dominant bezeichnet wird.
Hinterleuchtet man nämlich das weitverbreitete Denken über die Definition von Dominanz, klingt es immer gleich so, als wolle der Hund mit aller Gewalt und Aggression die Weltherrschaft übernehmen wollen. Ein Mythos, der zum Glück auch schon lange von der Wissenschaft verabschiedet worden ist. Denn Dominanz hat nichts mit Gewalt oder Aggression zu tun. Ganz im Gegenteil! Das dominantere Individuum hat es nicht nötig, seine Privilegien mit Gewalt durchzusetzen. Es ist selbstsicher, klar und verantwortungsbewusst und kann sogar Ressourcen wie Futter oder Spielzeug freigeben, ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone bricht bzw. der Status darunter leidet.
Ein kleines Alltagsbeispiel:
Welcher Hundehalter kennt es nicht; man trifft im Wald auf ein weiteres Mensch-Hund-Team, kommt ins Gespräch und läuft gemütlich zusammen weiter. Während man so plaudert, toben die Hunde zusammen. Irgendwann gerät das Toben ein wenig aus dem Ruder und man versucht seinen Hund aus der Situation abzurufen. Kommt der (junge) Hund dann trotz verzweifelter Rückrufversuche nicht her, hat der andere, bestens informierte, Hundehalter natürlich die Erklärung parat: der (Jung)Hund testet seine Grenzen aus und ist (na logisch!) dominant. Im schlechtesten Fall, bekommt man dann auch noch „hilfreiche“ Tipps wie: „Also da müssen Sie jetzt aber mal sofort zum Hund hin, ihn im Nacken packen und auf den Rücken werfen. Der muss jetzt wissen, wer bei ihnen das sagen hat!“
Dabei hat Ungehorsamkeit nichts mit Dominanz zu tun.
Es zeigt nur auf, dass das jeweilige Training noch nicht intensiv, konsequent und eindeutig genug war. Schlichtweg; der Hund hat noch nicht 100%ig begriffen, warum sich das Abwenden aus der gerade hochinteressanten und spaßigen Situation für ihn lohnt. Der Lösungsansatz darf keine Gewalt dem Hund gegenüber sein, sondern intensives Training mit dem Hund, bei dem er lernt, dass es sich (IMMER) lohnt beim ersten Rufen zum Menschen zurückzukommen!
Wichtig ist auch zu erwähnen, warum das alte Dominanzmodell völliger Quatsch ist:
In den 1920er Jahren wurde erstmals die Hierarchie bei Hühnern untersucht. Hierbei wurde eine so genannte „Hackordnung“ erkannt. Diese wurde dann in den 1930er Jahren auf die Wölfe und im Anschluss auf unsere Haushunde übertragen. Diese Untersuchungen haben belegt, dass das Alphatier in einem Wolfsrudel seine Position durch aggressives Verhalten gewinnt und verteidigt. Diese Untersuchungen waren schlichtweg lückenhaft und dadurch fehlerhaft. Sie wurden in künstlich zusammengestellten und in Gefangenschaft lebenden Wolfsrudeln durchgeführt. Die Verhaltensforscher setzten sich damals mit Papier und Stift hin und notierten was sie sahen. Während sie aber notierten, konnten sie nicht sehen, was weiter geschah. Wichtige Zusammenhänge und Interaktionen gingen ihnen somit verloren. Da aggressives Verhalten sehr auffällig ist, wurden bei diesen Beobachtungen hauptsächlich aggressive Verhaltensmuster notiert.
Nichts desto trotz, macht es wenig Sinn Hund und Wolf miteinander zu vergleichen. Denn Hunde agieren nicht in Rudeln wie man sie von Wölfen kennt, sondern eher in losen Gruppen mit familien-ähnlicher Struktur ohne Rudelführer oder Alpha-Hund. Freilebende Haushunde (z.B. in Indien oder Italien) gruppieren sich an Orten wo Nahrung, Fortpflanzungspartner und Sozialpartner gefunden werden. Der wesentliche Unterschied zu Wolfsrudeln liegt darin, dass die Bindungen untereinander nicht so stark ausgeprägt sind und soziale Kontakte auch unterhalb verschiedener Gruppen bestehen.
Warum konnte sich der Begriff der Dominanz dann trotzdem Jahrzehnte lang so sehr durchsetzen und etablieren?
Leider ist die Antwort auf die Frage einfach und traurig zugleich: der Mensch hat sich den dominanten Hund zu seinem Nutzen ausgelegt.
Er nimmt sich so selbst aus der Verantwortung, wenn ja der „dominante Hund“ Schuld an dem Verhalten ist. Ebenso kennen wir die These: „Wenn ein Mensch Macht hat, nutzt er diese aus.“. So fühlt er sich größer, wenn er seinen Hund klein macht. Leider ist situative Gewalt und Unterwerfung des Hundes auch ein Ventil für den Mensch, wenn dieser total genervt oder gestresst vom nicht hörenden Hund ist. Da steht man dann mit einem anderen Hundehalter im Wald und versucht zig mal, erfolglos, seinen Hund abzurufen. Ein Gefühl der Ohnmacht, Scham und Überforderung staut sich in einem an. Den Hund dann dafür zu bestrafen, indem man gar körperlich wird, bietet vielen Menschen ein schnelles und effektives Ventil für diese Emotionen. Am Ende ist dann der Hund augenscheinlich für alle der „Böse“ und nicht man selbst, weil man dem Hund und dessen Training eventuell doch zu wenig Zeit gewidmet hat. Zudem reagiert der Hund, auf solch ein Verhalten des Menschen, oft ängstlich, überfordert und eingeschüchtert. Diese Reaktion wird dann oft als „schlechtes Gewissen“ verstanden, welches den Menschen dann wiederum bestärkt, richtig gehandelt zu haben („Siehst du, er weiß ganz genau warum er gerade Ärger bekommt! Er hat ein richtig schlechtes Gewissen!“).
Gerade bei wilden „Pubertieren“ ist es also wichtig, das Verhalten genau unter die Lupe zu nehmen. Sie sind oft unsicher und einfach Opfer ihrer eigenen Entwicklung. Mit dieser riesen Baustelle im Kopf wirkt das „Pubertier“ somit schnell aufmüpfig und dominant, obwohl es nur verunsichert Anfragen von unten nach oben stellt. Gerade in dieser für den Hund äußerst stressigen Phase der Pubertät und Adoleszenz ist es also wichtig, konsequent, klar und ruhig zu bleiben. So ist man seinem Hund in dieser aufreibenden Zeit ein sicherer und vertrauenswürdiger Partner und man kann gemeinsam weiter zu einem Team zusammenwachsen und lehnt sich nicht gegeneinander auf.